Verbirgt die Ostsee steinzeitliche Megastrukturen? Neues Forschungsprojekt „Seascape“ startet in Warnemünde
Am Grund der westlichen Ostsee könnten sich bislang unbekannte Zeugnisse der Menschheitsgeschichte verbergen: monumentale Steinstrukturen, errichtet von Jägern und Sammlern der Steinzeit. Diesem spannenden Verdacht geht nun das neue Forschungsprojekt Seascape nach. Gestern fand der offizielle Projektauftakt am Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) statt.
Sensationsfund vor Rerik
Ausgangspunkt ist ein spektakulärer Fund: In der Mecklenburger Bucht entdeckten Forschende in etwa 21 Metern Tiefe eine rund einen Kilometer lange Steinreihe. Sie liegt am Rand eines ehemaligen Sees – einer Landschaft, die vor rund 11.000 Jahren noch nicht von der Ostsee überflutet war. Erste Hinweise sprechen dafür, dass es sich um eine von Menschen errichtete Jagdanlage aus der Spätzeit der letzten Eiszeit handeln könnte. „Wir wollen nun herausfinden, ob diese Struktur tatsächlich künstlich ist – und wenn ja, was sie über das Leben der damaligen Menschen aussagt“, erklärt Projektleiter Dr. Jacob Geersen, Meeresgeologe am IOW.
Mehr als nur ein Fund
Doch Seascape blickt über diesen Einzelfund hinaus: Auch in der Flensburger Förde und im Fehmarnsund wurden durch ältere Messungen auffällige Unterwasserstrukturen entdeckt, die bisher kaum erforscht sind. Sie sollen nun mit modernster Technik kartiert und untersucht werden.
Ein weiteres Ziel des Projekts ist es, die damalige Umwelt und Landschaft zu rekonstruieren – also herauszufinden, wie die untergegangenen Küstenstreifen einst aussahen und genutzt wurden.
Enge Zusammenarbeit vieler Disziplinen
Seascape ist ein gemeinsames Vorhaben mehrerer Einrichtungen: Neben dem IOW sind auch das Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA), die Universität Rostock, die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) sowie die archäologischen Landesämter von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein beteiligt. „Dieses Projekt ist nur durch die enge Zusammenarbeit von Archäologen, Geologen und Umweltforschern möglich“, betont Geersen. Die Förderung von rund 1 Million Euro kommt aus der Leibniz-Förderlinie „Kooperative Exzellenz“.
Auszeichnung für visionäre Forschung
Bereits im Dezember 2024 wurde Seascape mit einem Anerkennungspreis des Norddeutschen Wissenschaftspreises ausgezeichnet – für seinen innovativen Ansatz, Archäologie und Meeresforschung zu verbinden.
In den kommenden drei Jahren will das Team nicht nur verborgene Relikte untersuchen, sondern auch unser Verständnis von der frühen Besiedlung Nordeuropas erweitern. Vielleicht wird die Ostsee bald als Schatzkammer steinzeitlicher Kulturlandschaften neu entdeckt.
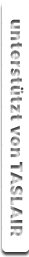
Kommentieren Sie den Artikel