Neuer Hochhauskompass für Rostock: Wegweiser für künftige Stadtentwicklung – einstimmig im Ortsbeirat Warnemünde beschlossen
Hochhäuser ja – aber nur dort, wo es städtebaulich, ökologisch und historisch vertretbar ist: Mit dem neuen Hochhauskompass hat die Stadt Rostock ein wichtiges informelles Planungsinstrument auf den Weg gebracht, das künftig als Leitlinie für mögliche Hochhausprojekte dienen soll. In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates Warnemünde/ Diedrichshagen wurde der Kompass von Anke Grewe vom Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität vorgestellt – und im Anschluss einstimmig vom Gremium beschlossen.
Ein Jahr intensive Analyse und Beteiligung
Rund ein Jahr lang wurde an dem Konzept gearbeitet. Ein Berliner Planungsbüro übernahm die Aufgabe, Rostocks bestehende Hochhauslandschaft systematisch zu analysieren, Potenzialräume zu definieren und Ausschlusskriterien festzulegen. Schutzgebiete wie Naturschutzflächen, Waldgebiete, Richtfunktrassen, Kleingartenanlagen, Denkmalschutzbereiche und historische Ortskerne wurden als tabu erklärt – sie gelten fortan als Sperrzonen für hochgeschossige Bebauung. „Die Stadt wurde gewissermaßen auf Hochhausverträglichkeit durchforstet“, so Anke Grewe. Im Fokus stand dabei nicht nur das Ob, sondern vor allem das Wo und Wie.
Gunsträume mit ÖPNV-Anbindung
Im Gegenzug wurden sogenannte „Gunsträume“ ermittelt – Areale, in denen aufgrund der Lage, Infrastruktur und Nutzungsstruktur Hochhausentwicklungen denkbar sind. Besonders gut erschlossene Verkehrsknotenpunkte stehen hier im Fokus. Die erarbeiteten Steckbriefe für alle Stadtteile definieren zudem standortspezifische Rahmenbedingungen.
Für Warnemünde wurden gleich zwei dieser Steckbriefe erstellt – einer für den historischen Ortskern, der andere für das Gebiet um die Warnowwerft, Neptunwerft, das Marinearsenal sowie den Fernbushaltepunkt Warnemünde Werft. Während für den eigentlichen Ortskern kein Hochhauspotenzial gesehen wird, könnten im Umfeld der Werften künftig höhere Gebäude entstehen – sofern sie in die städtebauliche Struktur passen.
„Anfangs standen sogar Bebauungen auf der Mittelmole, am Ortseingang oder entlang der Promenade zur Diskussion“, erinnert Grewe. Doch nach Gesprächen mit dem Gestaltungsbeirat und öffentlicher Beteiligung sei davon Abstand genommen worden. Die Mittelmole bleibt schützenswert – eine Einschätzung, die auch Jann-Henning Krause, Mitglied des Ortsbeirats Warnemünde, ausdrücklich teilt: „Der Bereich wurde bis auf Höhe Hotel Neptun als schützenswert besonders eingestuft. Damit ist klar: eine überhöhte Bebauung darf hier nicht stattfinden.“
Orientierung statt Vorgabe – aber mit klarer Richtung
Der Hochhauskompass ist ein sogenanntes informelles Planungsinstrument. Das bedeutet: Er hat keinen rechtlich bindenden Charakter, dient aber als Orientierung für Verwaltung, Politik und Investoren. In konkreten Bebauungsplänen können eigene Höhenfestsetzungen getroffen werden – wie etwa beim Werftbecken, wo laut Planungen künftig Gebäudehöhen von 25 bis 60 Metern denkbar sind.
„Uns war wichtig, dass es künftig keine ungeordnete Entwicklung gibt“, betont Axel Tolksdorff, Vorsitzender des Ortsbeirates. „Mit dem Kompass schaffen wir Planungssicherheit – für die Stadt, aber auch für Investoren. Es soll klar sein, wo solche Projekte denkbar sind – und wo eben nicht.“
Hochhäuser mit gestalterischem Anspruch
Der Hochhauskompass formuliert auch qualitative Anforderungen: Je nach Lage – ob zentral, nachbarschaftlich oder industriell – variieren die Ansprüche an Gestaltung, Nutzung und Einbindung ins Stadtbild. „Besondere Lagen verlangen höchste gestalterische Qualität“, so Grewe.
Eine erste öffentliche Informationsveranstaltung fand bereits vor gut einer Woche statt – auch Warnemündes Beiratsmitglieder Axel Tolksdorff und Jann-Henning Krause nahmen teil. Anke Grewe zeigte sich im Rückblick zufrieden: „Aus meiner Sicht war das eine sehr gute Veranstaltung – es wurde auch hart über Chancen und Risiken diskutiert.“
Ein Kompass für die Zukunft
Ob Wohnturm oder Bürobebauung: Der Hochhauskompass ist ein zukunftsgerichtetes Werkzeug für den sensiblen Umgang mit Höhe. Er ersetzt keine Bebauungspläne, aber er ergänzt sie.
Fazit: Kein Freifahrtschein für Bauwut, sondern ein gut abgewogener Wegweiser.
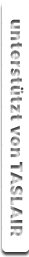
Kommentieren Sie den Artikel