Mehr Seegras in der Ostsee: KI hilft bei Renaturierung
Wie können Seegraswiesen in der Ostsee effizient und klimaresilient wiederhergestellt werden? Diese Frage steht im Mittelpunkt des neuen Forschungsprojekts Seaguard, das vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) koordiniert wird und diesen Sommer gestartet ist. Aktuell treffen sich erstmals alle beteiligten Forschenden für zwei Tage am IOW, um die nächsten Schritte zu planen.
Das Projekt verbindet Meeresforschung, Datenanalyse und Umweltmanagement und wird bis November 2027 im Rahmen der KI-Leuchtturminitiative des Bundesumweltministeriums mit rund 1,8 Millionen Euro gefördert.
Seegras – wichtig für Biodiversität und Klima
Seegraswiesen sind wahre Multitalente: Sie dienen als Kinderstube für Fische, Lebensraum für viele Meerestiere, schützen die Küsten vor Erosion, stabilisieren Sedimente und speichern Kohlendioxid.
Doch die Bestände in der Ostsee sind stark zurückgegangen – durch Überdüngung, veränderte Lichtverhältnisse, intensive Nutzung der Küstenbereiche und durch Temperaturstress im Sommer. Die Verluste gefährden nicht nur die Biodiversität, sondern schwächen auch die Fähigkeit der Ostsee, Kohlenstoff zu speichern.
Bisher fehlten belastbare Daten, um Seegras gezielt wieder anzusiedeln. Bestehende Modelle lieferten meist nur grobe Annäherungen und konnten Unsicherheiten aus Klima- oder Nährstoffszenarien kaum berücksichtigen.
Künstliche Intelligenz als Hilfe
Hier setzt das Projekt Seaguard (kurz für: Seagrass Growth and Adaptation Using AI Research and Development) an. Ziel ist es, KI zu nutzen, um die ökologischen Prozesse in Küstenmeeren besser zu verstehen und künftige Entwicklungen zuverlässig vorherzusagen.
Die Meeresforscher werten dafür große Mengen an Mess- und Satellitendaten aus – zum Beispiel zu Wassertrübung, Temperatur und Nährstoffen – und ergänzen sie durch KI-gestützte Modelle. Die KI erkennt Muster und zeigt, wo Seegras künftig erfolgreich wachsen kann. Auch verschiedene Klima- und Nährstoffszenarien werden berücksichtigt.
Das Ergebnis: hochaufgelöste Karten möglicher Seegras-Flächen, die eine gezielte Planung von Renaturierungsmaßnahmen ermöglichen. Gleichzeitig reduziert KI den Energieaufwand für Simulationen – ein Beitrag zu nachhaltiger Forschung.
„Mit Seaguard verbinden wir modernste KI-Forschung mit praktischem Naturschutz“, sagt Florian Börgel, Nachwuchsgruppenleiter am IOW. KI helfe nicht nur, ökologische Prozesse zu verstehen, sondern unterstütze ganz konkret beim Schutz und der Wiederherstellung von Lebensräumen.
Praxisnahe Anwendung und offene Werkzeuge
Die im Projekt entwickelten Modelle und Werkzeuge, darunter eine Web-App zur Visualisierung potenzieller Seegrasstandorte, sollen offen zugänglich sein und auch in anderen Küstenregionen genutzt werden können.
Bereits jetzt zeigen Umweltbehörden Interesse: Die Landesämter für Umwelt in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wollen die Daten künftig in ihre Monitoring-Programme einbinden. Seaguard leistet so einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung nationaler und europäischer Umweltstrategien.
Kick-off in Warnemünde
Das zweitägige Auftakttreffen am 6. und 7. November bringt rund 20 Forscher zusammen, die bereits seit Juli arbeiten. Partner sind neben dem IOW die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und die Eomap GmbH, spezialisiert auf Satelliten-Fernerkundung.
Teil der KI-Leuchtturminitiative
Seaguard ist eines von acht neuen KI-Leuchtturmprojekten, die das Bundesumweltministerium fördert. Ziel der Initiative ist es, digitale Technologien für Klima- und Umweltschutz einzusetzen und innovative Lösungen für ökologische Herausforderungen zu entwickeln.
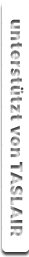
Kommentieren Sie den Artikel