Gefährliche Bakterien auf dem Vormarsch: Klimawandel treibt Ausbreitung von Vibrionen voran
Warnemünde – Der Klimawandel erwärmt nicht nur die Meere, er schafft auch neue Lebensräume für potenziell gefährliche Bakterien. Eine internationale Studie des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) zeigt nun erstmals im Detail, wie sich der Wundbranderreger Vibrio vulnificus weltweit ausbreitet – und welche Umweltfaktoren diese Entwicklung beschleunigen.
Publiziert in der Fachzeitschrift Communications Earth & Environment liefert die Analyse eine ernüchternde Botschaft: Das Bakterium ist nahezu in allen Küstenregionen der Erde nachweisbar. Besonders häufig tritt es dort auf, wo die Wassertemperaturen vergleichsweise hoch, die Salzgehalte mittel und Algenblüten im Zerfall sind. Damit deutet sich ein klarer Zusammenhang zwischen steigenden Meerestemperaturen und einem wachsenden Infektionsrisiko für den Menschen an.
Globale Datenbasis für ein lokales Risiko
Das IOW-Forschungsteam um den Meeresmikrobiologen Matthias Labrenz und die Bioinformatikerin Christiane Hassenrück wertete mehr als 70.000 Umwelt-DNA-Datensätze aus. Sie wurden in den vergangenen zehn Jahren weltweit aus Küstengewässern gesammelt – von der Antarktis bis in die Arktis. Die Ergebnisse sind eindeutig: Rund 45 Prozent aller Nachweise stammen aus den Tropen, doch auch in nördlicheren Regionen wie der Ostsee ist ein deutlicher Anstieg zu beobachten.
„Unsere Auswertungen zeigen eine Verschiebung nach Norden. In nahezu jedem Jahr zwischen 2013 und 2021 gab es mehr Nachweise in kühleren Regionen“, sagt Labrenz. „Das ist ein klarer Fingerzeig auf den Einfluss des Klimawandels.“
Wichtige Einflussfaktoren
Die Forscher identifizierten vier entscheidende Parameter:
- Wassertemperatur: Vibrio vulnificus tritt fast ausschließlich in Gewässern über 15 Grad Celsius auf.
- Phytoplankton-Blüten: Deren Zerfall liefert Nährstoffe, die das Wachstum der Bakterien fördern.
- Salzgehalt: Besonders häufig ist das Bakterium bei mittleren Salzgehalten von 5 bis 20 Prozent zu finden – wie sie für die Ostsee typisch sind.
- Strömungsgeschwindigkeiten: Niedrige Strömungen begünstigen, starke Strömungen hemmen das Vorkommen.
Auf Basis dieser Faktoren entwickelte das Team ein Vorhersagemodell, das Hochrisikogebiete identifizieren kann. Erste Tests, unter anderem mit Daten aus der Ostsee, zeigten eine gute Übereinstimmung zwischen Modell und tatsächlichen Infektionsfällen.
Gesundheitsgefahr nimmt zu
Vibrio vulnificus kann beim Baden bereits über kleinste Wunden in den Körper eindringen. Bei gesunden Menschen heilt eine Infektion meist folgenlos ab. Gefährdet sind jedoch Ältere und Personen mit geschwächtem Immunsystem: Hier kann es im schlimmsten Fall zu einer Sepsis kommen, die tödlich verläuft oder eine Amputation erfordert.
„Bislang sind schwere Infektionen an der deutschen Ostseeküste selten. Auf viele Millionen Urlaubsgäste kommen im deutschen Ostseeraum jährlich kaum mehr als ein bis zwei Todesfälle, doch die Risiken steigen“, warnt Labrenz. Gründe seien neben der Erwärmung der Küstengewässer auch Überdüngung und die demografische Entwicklung.
Blick in die Zukunft
Die Forscher sehen ihre Ergebnisse als wichtigen Baustein für ein verbessertes Gesundheits- und Küstenmanagement. „Umso wichtiger ist es, mit unserem Modell zukünftig realistische Risikoszenarien und Risikokarten zu erstellen, um Küstenregionen und Gesundheitsbehörden frühzeitig warnen zu können“, betont Hassenrück. Gleichzeitig mahnt sie an, Infektionsdaten weltweit systematischer zu erfassen und stärker mit ökologischen Messungen zu verknüpfen.
Eines steht fest: Die Klimakrise betrifft nicht nur Eisberge und Meeresspiegel – sie macht auch unsichtbare Risiken sichtbar, die direkt vor der eigenen Haustür liegen.
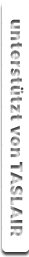
Kommentieren Sie den Artikel