Die Ostseeküste im Anthropozän: Modellregion für die Folgen des Klimawandels
Die Ostsee gilt als besonders sensibles Ökosystem, das die Folgen des Klimawandels in konzentrierter Form zeigt. Unter Federführung des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) haben Wissenschaftler in einem aktuellen Übersichtsartikel den Zustand der Ostseeküste und ihre zukünftige Entwicklung untersucht. Die Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Estuarine, Coastal and Shelf Science, zeigt auf, dass die Ostsee als Modell für die globalen Auswirkungen des Klimawandels dienen kann und dass interdisziplinäre Forschung unerlässlich ist, um Veränderungen in den flachen Küstenbereichen zu verstehen.
Küsten als Schlüsselregionen unter Druck
Die Ostsee ist ein Binnenmeer, das nur über das Kattegat mit der Nordsee verbunden ist. Der geringe Wasseraustausch führt dazu, dass Nähr- und Schadstoffe lange in der Ostsee verbleiben. Gleichzeitig erwärmt sich das Meer stärker als der offene Ozean. Mit rund 85 Millionen Menschen im Einzugsgebiet ist die Belastung durch menschliche Aktivitäten erheblich.
Die menschlichen Einflüsse an der Ostseeküste haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verstärkt, heißt es in der Studie. Nährstoffeinträge haben zur „Überdüngung des Wassers“ beigetragen, die das Auftreten giftiger Algenblüten fördert und Sauerstoffmangel begünstigt. Erst im September 2025 führte vermutlich eine Kombination aus Nährstoffbelastung und wetterbedingtem Auftrieb zu einem massiven Fischsterben nahe Rostock.
Der Klimawandel als Verstärker
Die Ostsee reagiert besonders empfindlich auf steigende Temperaturen, stärkere Stürme und marine Hitzewellen. Maren Voss, Erstautorin der Studie, betont: „In der Ostsee werden sich die Folgen des Klimawandels und des menschlichen Handelns in besonders konzentrierter Form zeigen.“
Besonderer Forschungsbedarf besteht bei den küstennahen, flachen Meeressedimenten, in denen Dauerstadien von Phytoplankton und Eier von Zooplankton vorkommen. Phytoplankton, darunter einzellige Algen und Cyanobakterien, kann während Blüten giftige Substanzen freisetzen. Zooplankton, wie kleine Ruderfußkrebse, dient als Nahrungsgrundlage für Fische. Wie diese Organismen auf steigende Meerestemperaturen reagieren, ist bislang nur unzureichend erforscht.
Mögliche Szenarien durch Klimawandel
Die Studie beschreibt verschiedene Risiken für die Ostsee: Hohe Nährstoffeinträge kombiniert mit steigenden Wassertemperaturen können zu häufigeren giftigen Algenblüten führen.
Abbau abgestorbener Algenblüten kann zu Sauerstoffdefiziten und Ausbreitung sogenannter Todeszonen auch im Flachwasser führen; zudem werden Treibhausgase wie Methan freigesetzt.
Intensive Küstennutzung, Rückgang von Seegraswiesen und Algenbeständen führen zum Verlust wichtiger Lebensräume für bodenlebende Tiere und Fischbrut.
Interdisziplinäre Forschung als Schlüssel
Die Wissenschaftler betonen die Notwendigkeit interdisziplinärer Forschung, um die Ostseeküsten langfristig zu überwachen und Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Regelmäßige Beprobungen flacher Küstengewässer sind methodisch anspruchsvoll. Neue Technologien wie am Meeresboden verankerte Messsysteme, Drohnen für Küstenprobenahmen oder optische Fernerkundung sollen künftig Daten effizienter liefern. Auch die Umwelt-DNA (eDNA) wird zunehmend eingesetzt, um Biodiversität nicht-invasiv zu erfassen.
Die Entwicklung von Modellen, die verschiedene Stressoren wie Nährstoffeinträge, Erwärmung und Meeresspiegelanstieg gleichzeitig räumlich hochauflösend abbilden, ist zentral. Nur so lassen sich realistische Szenarien für politische Entscheidungen im Küsten- und Meeresschutz erstellen.
Shore2Basin: Neue Forschungsinitiativen
Am IOW wurde das Programm Shore2Basin (S2B) gestartet, um die Beobachtung der flachen Ostsee-Küstenzonen zu intensivieren. Ziel ist es, die dynamischen Prozesse besser zu verstehen und neue Messmethoden zu entwickeln. Internationale Kooperationen, wie das Projekt CoastClim mit schwedischen und finnischen Universitäten, erweitern die Perspektive auf das gesamte Ostseesystem.
Im August 2025 startete das Forschungsschiff Elisabeth Mann Borgese zur ersten großen Fahrt im Rahmen des S2B-Programms. Weitere Expeditionen werden folgen, um die Datenbasis für Langzeitbeobachtungsprogramme und den Schutz der Ostsee zu erweitern.
Fazit
Die Ostsee zeigt in konzentrierter Form, wie Klimawandel und menschliche Einflüsse zusammenwirken. Steigende Temperaturen, Nährstoffeinträge und intensive Küstennutzung setzen das Ökosystem unter Druck. Interdisziplinäre Forschung, moderne Messtechnik und internationale Zusammenarbeit sind entscheidend, um die Folgen zu verstehen und Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Die Ostseeküste wird so nicht nur als Lebensraum für Mensch und Natur, sondern auch als Modellregion für globale Klimafolgen immer wichtiger.
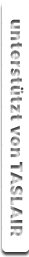
Kommentieren Sie den Artikel